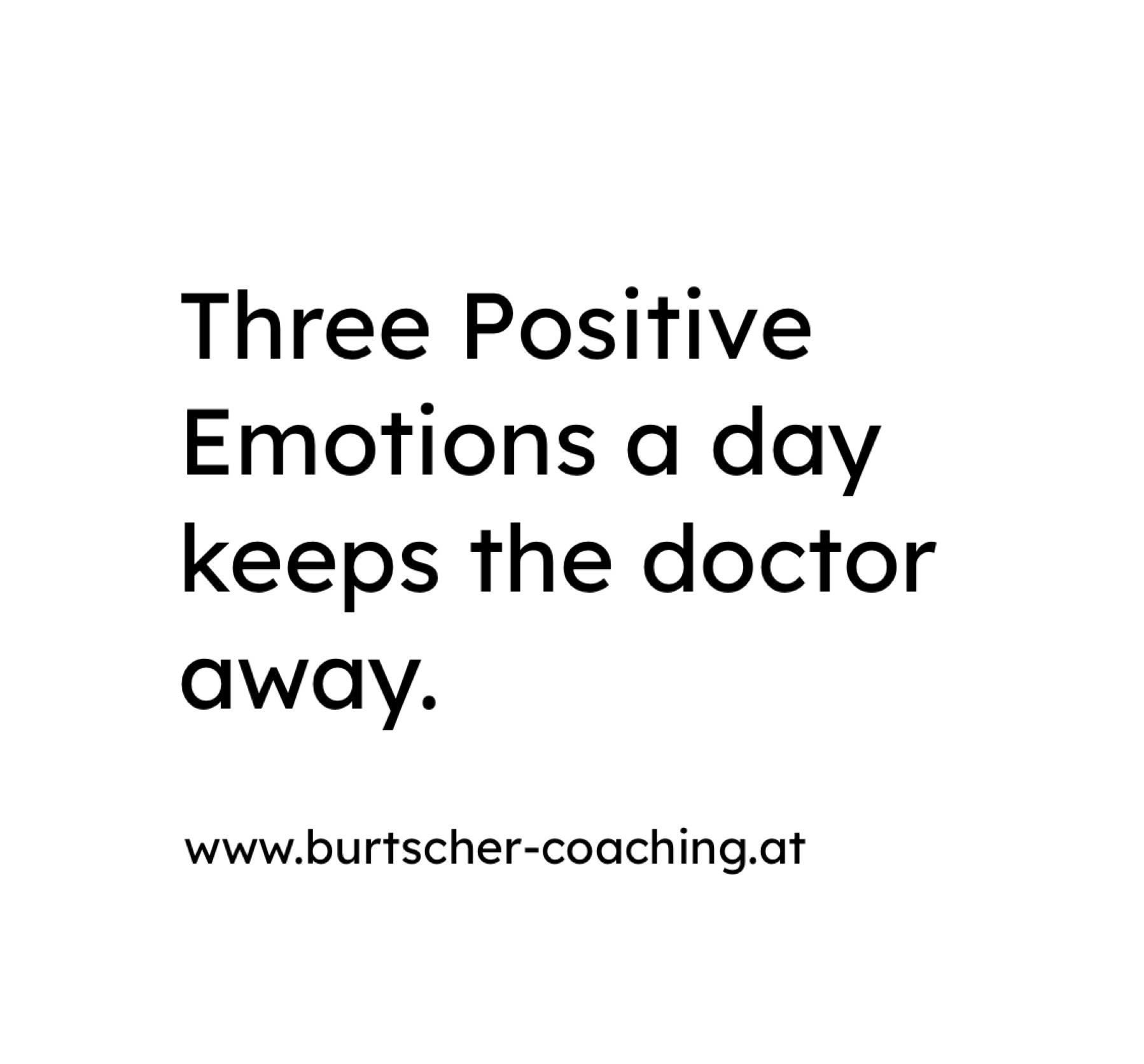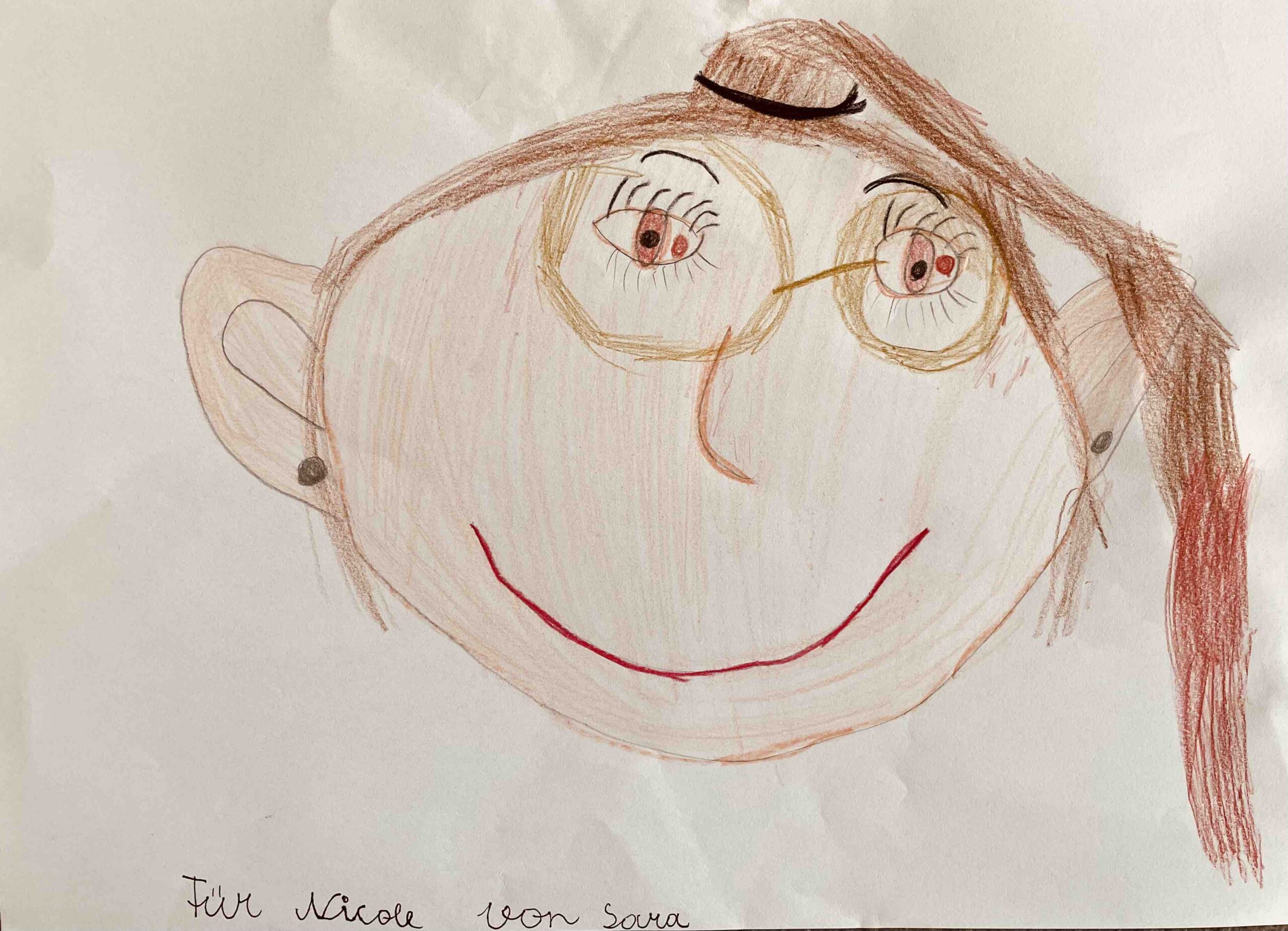5-Minuten Sanduhren geben dir den Impuls, die Zeit wieder bewusst zu genießen.
Foto: burtscher coaching beratung
Wach und aufmerksam durchs Leben zu gehen, ist in unruhigen Zeiten besonders schwer. Achtsamkeit kann helfen, wieder präsenter zu werden.
Wahrnehmungsproblem
Du hast an der Kassa bezahlt, verstaust das Wechselgeld sorgfältig in deine Geldtasche – und lässt deine Einkaufstasche liegen. Solche „Ausfälle“ tun wir ab als „schusselig“, „geistesabwesend“, „weggetreten – in Gedanken ganz woanders“. Offenbar haben wir uns schon daran gewöhnt, an das Leben mit „weit geschlossenen Augen“ (eyes wide shut). Gravierender wirkt sich das Abwesendsein in kritischen Situationen aus: Ein Stoppschild übersehen, zu spät erkennen, dass da noch eine Stufe kommt – die meisten Unfälle geschehen, weil die Person nicht richtig „da“ war.
Auch in einem dritten Bereich breitet sich eine folgenreiche Geistesabwesenheit aus: Wir werden immer unachtsamer im Umgang mit anderen. Wenn man beliebige Gespräche in unterschiedlichen Kontexten beobachtet, stellt man leicht fest, wie fast ständig aneinander vorbeigeredet wird, kaum jemand hört noch genau zu. Man fällt einander ins Wort, weil es wichtiger scheint, das Eigene loszuwerden. Ich bin zwei Monologe, sagte der Dialog.
Wie nie zuvor in der Geschichte wird das menschliche Gehirn mit Reizen bombardiert, wie nie zuvor müssen wir tagtäglich eine Vielzahl von Entscheidungen treffen, müssen ständig zwischen Wichtigem und weniger Wichtigem sortieren. Wir versuchen immer häufiger, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen („Multitasking“). Doch die Forschung zeigt: Alles gleichzeitig funktioniert nicht. Niemand kann mehrere komplexe Tätigkeiten gleichzeitig ausführen, das macht das menschliche Gehirn nicht mit. Vielmehr wechselt das Hirn rasant zwischen beiden Tätigkeiten hin und her. Das Ergebnis: Man bekommt nur die Hälfte mit.
Achtsam bleiben, auch wenn es schnell geht
Wir denken und reagieren auf die Anforderungen des Alltags „schnell“ mithilfe von Faustregeln, Formeln und Kategorien. Wir verlassen uns auf Erfahrungen, die wir irgendwann einmal gemacht haben, und wir haben einen Großteil der alltäglichen Verrichtungen so automatisiert, dass sie „wie von selbst“ ablaufen und unserer Geistesgegenwart gar nicht bedürfen: Arbeiten, Autofahren, Essen, Routinetätigkeit und vieles mehr wird von einer Art „Autopilot“ erledigt, den wir einschalten. Die Forschung zeigt: Es ist grundsätzlich immer möglich, achtsam zu bleiben und zu erkennen, was uns beeinflusst und was mit uns passiert.
Was ist Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist ein Geisteszustand, in dem wir offen und sensibel sind für Neues, selbst in vertrauten Situationen. Achtsam sein bedeutet, die Wahrnehmung zu schärfen und überall Nuancen und Veränderungen zu erkennen. Achtsamkeit ist die Kunst, die feinen Unterschiede wahrzunehmen. Wer achtsam ist, ist ganz bei der Sache und verschafft sich dadurch immer wieder neu ein unvoreingenommenes Bild der Realität. Er kann flexibler und langfristig erfolgreicher reagieren. Achtsamkeit ist aber mehr als nur Konzentration – also die Fokussierung auf einen Gedanken oder ein Objekt. Im Zustand der Achtsamkeit bleiben wir offen für alle Aspekte einer Situation und bleiben so mehr in der Beobachtung als in der Bewertung.
Achtsamkeit basiert auf vier Voraussetzungen
Über-Bewusstheit: Wir verlieren uns nicht in einer Tätigkeit, sondern sind uns bewusst, dass wir etwas Bestimmtes tun (z. B. beobachten).
Nicht abgelenkt sein: Keine „Nebengeräusche“ wie Grübeleien, Zukunftssorgen oder Gefühlsaufwallungen beeinträchtigen unsere Wahrnehmung.
Neutralität: Wir enthalten uns jeglichen Urteilens und Wertens dessen, was wir wahrnehmen und nehmen alles erst einmal „unbenotet“ in uns auf, selbst wenn uns vieles bekannt vorkommt und wir versucht sind, auf Erfahrungen und Vorurteile zurückzugreifen. Achtsamkeit ist „präreflexiv“ – sie registriert lediglich, was geschieht, ohne sich schon in bestimmte Gedanken oder Gefühle einzuklinken.
Perspektivenwechsel: Im Zustand der Achtsamkeit und der Neutralität bleibt uns bewusst, dass man die Dinge aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann: Andere Menschen sehen die Dinge anders als wir. Sie haben wahrscheinlich gute Gründe für ihre Betrachtungsweise, und unsere eigene Sichtweise kann falsch, beschränkt oder einengend sein.
Welche Probleme wir bei der Wahrnehmung haben
Wir haben für die Gegenwart den „Autopiloten“ eingeschaltet. Entweder eilen uns die Gedanken voraus und wir beschäftigen uns mit zukünftigen Dingen, oder wir flüchten uns angesichts einer langweiligen oder unangenehmen Gegenwart in Tagträume oder Grübeleien darüber, wie wir Ereignisse in der Vergangenheit besser hätten meistern können. In jedem dieser Modi stellen wir uns nicht dem, was uns der Augenblick abverlangt, mit unseren vollen geistigen Kapazitäten.
Wer unachtsam lebt, verliert aus dem Blick, dass er die Dinge auch ganz anders, vielschichtiger und „informativer“ sehen könnte. Unachtsamkeit hält uns gefangen in einem Spektrum des Denkens und Handelns, das in der Vergangenheit definiert worden ist. Die Möglichkeit von Veränderungen wird ausgeblendet.
Nur scheinbar vertraut?
Es kommt darauf an, auch in scheinbar vertrauten Situationen das Neue zu erkennen oder in einer gewohnten Situation eine neue Perspektive zu erproben. Mehr denn je müssen wir offen bleiben für die Möglichkeit, dass sich die Hypothesen unseres Handelns verändert haben. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel hilft uns, wenn „bewährte“ Problemlösungen nicht mehr taugen.
Achtsam sein heißt, innere und äußere Vorgänge mit ungeteilter, entspannter Aufmerksamkeit zu beobachten, diese Haltung erhöht die Lebhaftigkeit, Farbigkeit, Realität der Eindrücke – wir nehmen „das ganze Bild“ in uns auf. Die Achtsamkeit reicht weit in die emotionale Intelligenz, weil sie das klare Erkennen fremder und vor allem auch eigener emotionaler Befindlichkeiten unterstützt – wir wissen, was uns gerade bewegt oder beeinflusst, und können so gegensteuern oder moderieren.
Achtsam frühstücken – geht das?
Achtsam zu leben bedeutet nicht, jeden Aspekt unserer Umwelt gleichermaßen intensiv zu beachten. Es geht auch nicht um angestrengtes „Aufpassen“. Achtsam ist man „ganz entspannt im Hier und Jetzt“. Kann man beispielsweise achtsam frühstücken? Heißt das, etwa die Besonderheit jeder einzelnen Haferflocke, die wir zum Frühstück in den Teller schütten, zu betrachten? Sicher nicht. Aber indem man auch beim Frühstücken „präsent“ bleibt, fällt einem auf, wenn etwas aus der Haferflockenpackung fällt, das dort nicht hineingehört. Und man schmeckt und riecht und genießt das Frühstück, wenn man in Gedanken nicht schon bei der Arbeit ist.
Richtig üben
Übung macht den Meister! Stimmt das? Ja, aber nur, wenn man achtsam übt! Stures Pauken vermindert die Leistung. Intellektuelle oder motorische Fertigkeiten werden meist in der Absicht gelernt, sie möglichst schnell „wie im Schlaf“ zu beherrschen. Wir lernen, nein, wir büffeln die Grundlagen oder Bausteine einer Sprache, einer Sportart, eines Spiels, um möglichst schnell zu einem höheren Stadium, zur Könnerschaft aufzusteigen. Aber ist es sinnvoll, das Begreifen einer Aufgabe ausgerechnet in einem Stadium zu automatisieren, in dem wir noch blutige Anfänger sind und das Einmaleins lernen? Besser wäre es, gerade dann offen zu bleiben für jede Nuance, für jede Veränderung der Situation.
Spitzenkönner in allen Bereichen unterscheiden sich von weniger Guten gerade dadurch, dass sie eine achtsame Anfängermentalität beibehalten und immer wieder die „selbstverständlichen“ Grundlagen ihres Metiers infrage stellen. So verbessern sie immer wieder neu ihre Basisfähigkeiten – und damit ihre Gesamtperformance.
Auf andere achten
Achtsamkeit ist auch die Basis guter sozialer Beziehungen: Wer aufmerksamer im Umgang mit anderen ist und sich gleichzeitig vorschneller Urteile enthält, wird eher gemocht und geschätzt. Denn Achtsamkeit wird als Zuwendung und Respekt empfunden.
Wer seine Kinder aufwachsen sieht, ist in der Regel noch achtsam engagiert – er registriert sensibel jeden noch so kleinen Entwicklungsfortschritt. Diese Aufmerksamkeit verflüchtigt sich, wenn das Kind älter wird, sich das Entwicklungstempo verlangsamt und scheinbar weniger passiert. Und erst recht unachtsam werden wir in vielen Beziehungen, in denen wir von einer falschen Stabilität ausgehen: Vor allem in den lang andauernden und daher eigentlich wichtigsten Beziehungen wie Ehen und Freundschaften haben wir verlernt, zu fragen und auf kleine Veränderungen zu achten, weil wir glauben zu wissen, was der oder die andere denkt. Wir wissen ja, wie wir selbst in einer ähnlichen Situation gedacht haben, und so überschätzen wir die Übereinstimmung anderer mit unseren eigenen Meinungen und Bewertungen.
Achtsam leben ist gesund
Wer achtsam lebt, lebt gesünder – und wahrscheinlich auch länger: Achtsamkeit wirkt sich günstig auf eine ganze Reihe von Gesundheitsparametern aus, denn achtsame Menschen registrieren emotionale und physiologische Veränderungen bei sich früher und können darauf reagieren. Sie sind deshalb eher in der Lage, Syndromen wie Burn-out, Depression, hohem Blutdruck und anderen psychosomatischen Gefährdungen vorzubeugen. Wer unachtsam lebt, nimmt Warnsignale und Symptome oft nicht rechtzeitig wahr, mit negativen Folgen für die Gesundheit.
Wenn Achtsamkeit uns also klüger, gesünder und glücklicher macht – was können wir tun, um präsenter zu sein? Wie schaffen wir es, unseren schnellen, aber langfristig abträglichen Denkschemata zu entkommen? Achtsamkeit lässt sich am besten erreichen, wenn man von vornherein vermeidet, unachtsam zu sein. Um Unachtsamkeit zu vermeiden, müssen wir uns klar machen, dass die Wahrheit jeder Information von ihrem Kontext abhängt. Wenn wir also etwas wahrnehmen, sollte uns bewusst sein, dass es sich nie um eine absolute Tatsache handelt. Um achtsam zu bleiben, müssen wir einen gesunden Respekt vor Unsicherheit kultivieren. Um einer Sache achtsam zu begegnen, sollten wir aktiv und bewusst nach Unterschieden suchen. Das tun wir nicht, sobald wir glauben, ein Ding, einen Ort oder einen Mensch bereits in- und auswendig zu kennen. Die Erwartung von etwas Neuem dagegen hält uns wachsam und achtsam.
Präsenter werden
Wer nun von Natur aus eher unachtsam ist, braucht also nicht zu verzweifeln. Achtsamkeit, welcher Definition sie auch immer folgt, lässt sich lernen und üben. Wer es lernt, achtsam zu sein, wird ruhiger, kann sich besser konzentrieren und fühlt sich entspannter. Achtsamkeit verhilft auch dazu, dass man eigene Gefühle besser und genauer wahrnimmt und bemerkt, ob ein Gefühl das andere verschleiert. So lässt sich beispielsweise mit Wut Trauer verdecken. Wer lernt, eigene,auch zwiespältige Gefühle erst einmal wertfrei zu akzeptieren, kann daraus Energie ziehen und besser entscheiden.
In manchen Fällen ist aber Vorsicht angesagt: Wem es schlecht geht, wer aufgewühlt und unruhig ist, wer in einer Krise ist, für den reicht Achtsamkeit wahrscheinlich nicht aus und man ist vielleicht gar nicht fähig dazu. Dann braucht man zusätzliche Problemlösestrategien und manchmal professionelle Hilfe wie ein Coaching oder eine Psychosoziale Beratung.
Die Stop-Modell Übung
S – Stop (Stresskreislauf unterbrechen)
T – Take a breath (atmen, innehalten)
O – Observe (beoachten – Gedanken, Gefühle, Körper)
P – Proceed (weitermachen)
Mein Tipp
Achtsamkeit ist Mentaltraining. Je öfter wir neue Gewohnheiten trainieren und wiederholen, desto stärker verankert sie sich in unserem Unterbewusstsein. Wiederholung schafft Gewohnheiten und Gewohnheiten schaffen Resultate. Schaffe dir neue Trampelpfade für neue Gehirnstrukturen in deinem Gehirn.
Gut zu wissen: Nutze für deine Achtsamkeitsübungen die stilvolle Sanduhr, als Zeitmesser und mentales Hilfsmittel zum Nichtstun und Innehalten. Diese hübschen Sanduhren aus Glas geben dir den Impuls, die Zeit wieder bewusst zu genießen. Das Rieseln des Sandes zu beobachten wirkt sehr beruhigend und gleichzeitig trainierst du dabei deinen Achtsamkeitsmuskel. 5-Minuten Sanduhren aus Glas in drei Varianten bei mir erhältlich.
Coaching und Psychosoziale Beratung: Im Herbst absolvierte ich einen 8-wöchigen zertifizierten Lehrgang zu „Mindfulness Based Stress Reduction“ (MBSR) nach dem Original von Jon Kabat-Zinn – Stressbewältigung durch Achtsamkeit.
Ich freue mich, diese neue Kompetenz mit spannenden Inhalten und kleinen Alltagsübungen in meinen Coachings und Psychosozialen Beratungen weitergeben zu können.
Viel Erfolg beim achtsamen Üben wünscht dir
Deine Nicole
Quelle: Psychologie heute, Nicole Burtscher